Der Bundesrat berücksichtigte die korrigierten finanziellen Aussichten für die AHV. Die Ausgaben für die Alters- und Hinterlassenenversicherung dürften 2033 rund 4 Milliarden Franken tiefer ausfallen als bisher angenommen.
Defizit wächst weniger schnell
Die Kosten der 13. AHV-Rente liegen 2026 bei rund 4,2 Milliarden und 2030 bei knapp 5 Milliarden Franken, wie der Bundesrat am Mittwoch schrieb. Die korrigierten Finanzperspektiven hätten wenig Einfluss darauf.
Das Umlageergebnis der AHV wird mit der Einführung des «Dreizehnten» wie bereits mitgeteilt ab 2026 negativ. Gemäss den neuen Berechnungen des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) wächst das Defizit in den Folgejahren weniger schnell.
Daher erachtet der Bundesrat die Erhöhung der Mehrwertsteuer als angemessen für die Finanzierung der 13. AHV-Rente. Er ist zudem der Ansicht, dass die 13. Rente von Beginn weg nachhaltig finanziert werden sollte.
In der Vernehmlassung im Frühsommer hatte er dazu noch zwei Finanzierungsvarianten zur Diskussion gestellt: eine mit höheren Lohnbeiträgen allein und eine zweite mit einer Kombination von höheren Lohnbeiträgen und mehr Mehrwertsteuer. Die zweite Option habe eine Mehrheit in der Vernehmlassung unterstützt, schrieb der Bundesrat.
Umstrittener Vorschlag
Dennoch dürfte es die Erhöhung der Mehrwertsteuer schwer haben im Parlament. SVP und FDP lehnten Steuererhöhungen für die 13. Rente rundweg ab. Die Mitte-Partei, der Wirtschaftsdachverband Economiesuisse und der Arbeitgeberverband hingegen befürworteten eine höhere Mehrwertsteuer.
Und die SP erinnerte daran, dass sie im Abstimmungskampf für den «Dreizehnten» für höhere Lohnbeiträge plädiert habe. Auch die Grünen stellten sich hinter höhere Lohnbeiträge.
Etwas nachgegeben hat der Bundesrat beim Bundesbeitrag an die höheren AHV-Ausgaben: Statt der Senkung von 20,2 Prozent der Ausgaben auf 18,7 Prozent schlägt er nun eine Senkung auf 19,5 Prozent vor. Damit trage der Bundeshaushalt 2030 rund 500 Millionen Franken an die 13. AHV-Rente bei, schrieb er.
Auch die Kürzung des Bundesbeitrages soll aus der Erhöhung der Mehrwertsteuer gedeckt werden, schrieb er nun. Und zwar so, dass 2030 ein Fondsstand von 100 Prozent der AHV-Ausgaben erreicht wird. Wie stark die Mehrwertsteuer erhöht werden soll, will der Bundesrat im Herbst aufgrund der Finanzperspektiven der AHV bestimmen.
Zudem will der Bundesrat daran festhalten, die 13. AHV-Rente ab 2026 jährlich im Dezember auszuzahlen. In der Vernehmlassung habe dies eine deutliche Mehrheit unterstützt, schrieb er dazu.
Botschaft im Herbst
Die Botschaft ans Parlament will der Bundesrat im Herbst vorlegen. In der kommenden Wintersession und der Frühjahrssession 2025 sollen die Räte die Vorlage beraten können. Die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente hatten die Stimmenden im März 2024 gutgeheissen.
Für die Gesetzesänderungen für die Umsetzung der 13. Rente und für deren Finanzierung will der Bundesrat zwei Vorlagen ausarbeiten. Dadurch sei sichergestellt, dass die Gesetzesanpassungen zur Umsetzung des Volksentscheids in Kraft treten könnten, auch wenn es bei der Finanzierung zu Verzögerungen kommen sollte, schrieb er.
Eine Änderung der Mehrwertsteuer muss zwingend an die Urne. Gegen die Gesetzesänderungen kann das Referendum ergriffen werden.
(AWP)

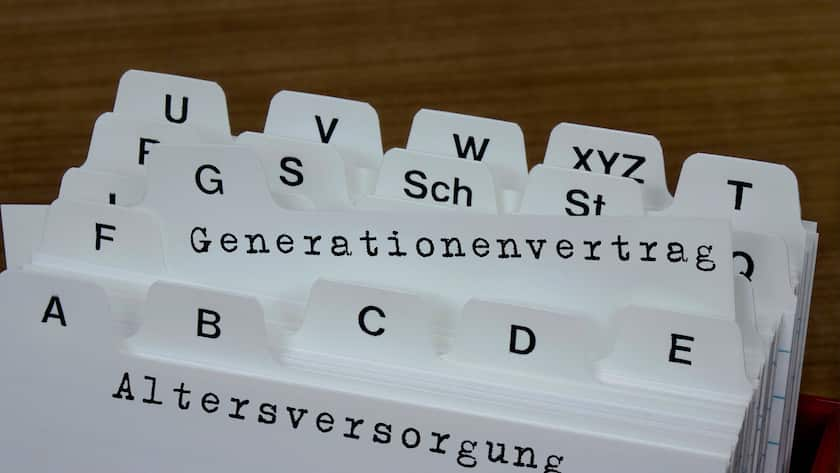
6 Kommentare
Es ist erstaunlich aber wahr, der Vorschlag vom Bundesrat zeigt einmal mehr, dass der Bundesrat selbst nicht einmal den MECANO und die Hauptaufgabe sowie den Zweck der AHV und der Mehrwertsteuer verstehen.
Die AHV Beiträge sind nicht anderes als zeitlich verschobenes Einkommen: Ich verzichten darauf, einen Teil meines heutigen Erwerbseinkommens zu verkonsumieren, damit ich im Alter, wo ich kein Erwerbseinkommen mehr habe, ein Einkommen aus der Altersvorsorge beziehen kann. Die AHV wird also aus Erwerbseinkommen generiert und aus nichts anderen. Und genau aus diesem Grund soll sich auch weiterhin nur über Lohnabzüge finanziert werden, damit das System in sich konsistent bleibt.
Was maximal störend ist an der Finanzierung über die MwSt , ist, dass auch Rentner, die ihren Beitrag zur AHV bereits geleistet haben, noch einmal dafür zahlen sollen. Das ist eine ungerechtfertigte Doppelbelastung.
Würde man jetzt über die MwSt. finanzieren, mit dem Argument, das dann alle mitfinanzieren, dann gelte dieses Argument aber nicht nur für den 13ten sondern für die ganze AHV. Also müsste man dann konsequenterweise die Lohnabzüge ganz abschaffen.
Unter dem Strich gilt es einmal mehr festzuhalten: Die AHV erfüllt heute ihren gesetzlichen Auftrag nicht, der da lautet, sie solle existenzsichernd sein. Das Parlament ist hier in der Pflicht und hat seit Jahrzehnten seinen Job nicht gemacht. Es ist an der Zeit, dass die AHV so aufgestellt wird, dass existenzsichern wird. Das geht nur mit (a) höheren Lohnabzügen, (b) Abführen von AHV auf Kapitalerträgen und (c) einem Systemwechsel weg vom Umlagesystem hin zu einem Anlagesystem, bei dem ein Staatsfonds ähnlich Norwegen das Volksvermögen verwaltet.
b.)Abführen von AHV auf Kapitalerträgen, das dümmste was es gibt, dann ist das Geld alles in Luxenburg inkl. Arbeitsplätzen. Wohl eher Stempelsteuer abschaffen mehr Geld anziehen, dann gibt es über mehr Kapital mehr Arbeitsplätze mehr Konsum und am Schluss daraus mehr Steuerertrag. Bitte weiterdenken Danke.
Ihr könnt es drehen und wenden wie ihr wollt, aber Fakt ist, dass die Kosten entweder die Lohnstückkosten oder direkt beim Endverbraucher steigen werden. Notabene auch bei den Immobikosten und Mieten.
Nicht zu vergessen, die Steuerbehörde isst mit.
Du hast recht. Man kann es drehen wie man will. Wenn man kein faires Geld hat, funktioniert es einfach nicht.
Übrigens hätte man dazu ja die Steuern und nicht die Mehrwertsteuer. Steuer auf Mehrwerte?
Würde Ihre Aussage stimmen, wäre es ja konsequent, die Finanzierung über die AHV Beiträge zu machen, da es ja eh am Schluss bei den Lohnstückkosten ankommt?
Ich bin zwar der Meinung, dass die Finanzierung nur über die AHV Beiträge gemacht werden darf, aber Ihre Aussage stimmt bezgl. der MwSt nicht. Ihrer Aussage nach müsste die ganze Erhöhung der Mehrwersteuer in entsprechendem Umfang zur Erhöhung der Löhne führen, nur so würden die Lohnstückkosten steigen. Und das wird sicher nicht passieren, weil (a) ein Teil der MwSt nicht aus Lohneinkommen sondern aus Alterseinkommen, Kapitaleinommen und Vermögen finanziert wird und (b) die wenigsten Arbeitnehmenden eine ausreichende Preissetzungsmacht haben, um eine entsprechende Lohnanpassung einzufordern.